Magie erforschen? Geht das überhaupt?
Zwischen Labor und Lagerfeuer: In diesem Beitrag erzähle ich, wie ich für meinen Roman Der verbotene Frühling Biologie, finnische Mythologie und stille Momente der Liebe miteinander verknüpft habe – von Gesprächen mit Studierenden der Uni Helsinki bis zu den Sagenfiguren Lempo und Sukkamieli.
Melisande D. Menze
8/19/20257 min read
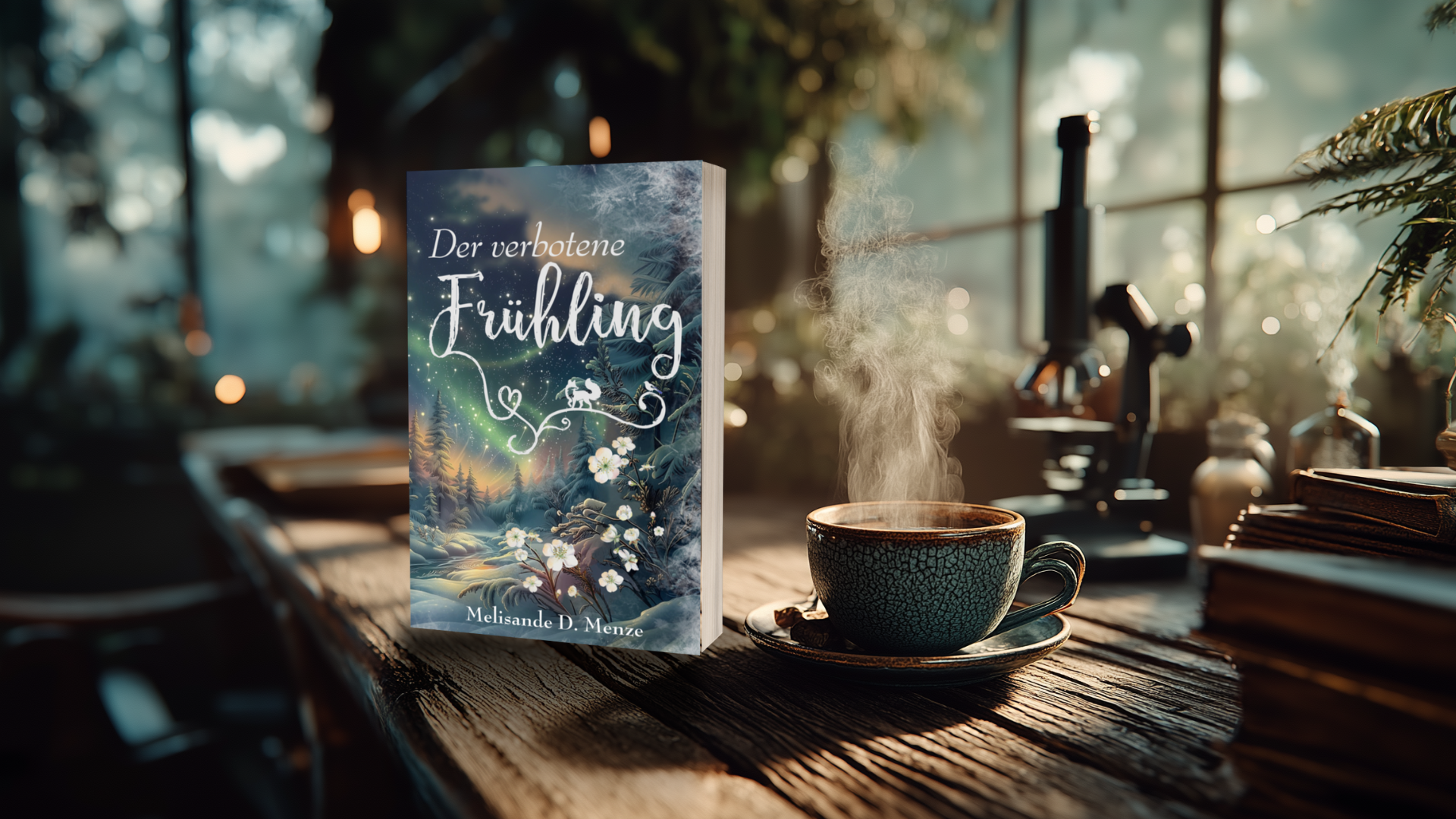
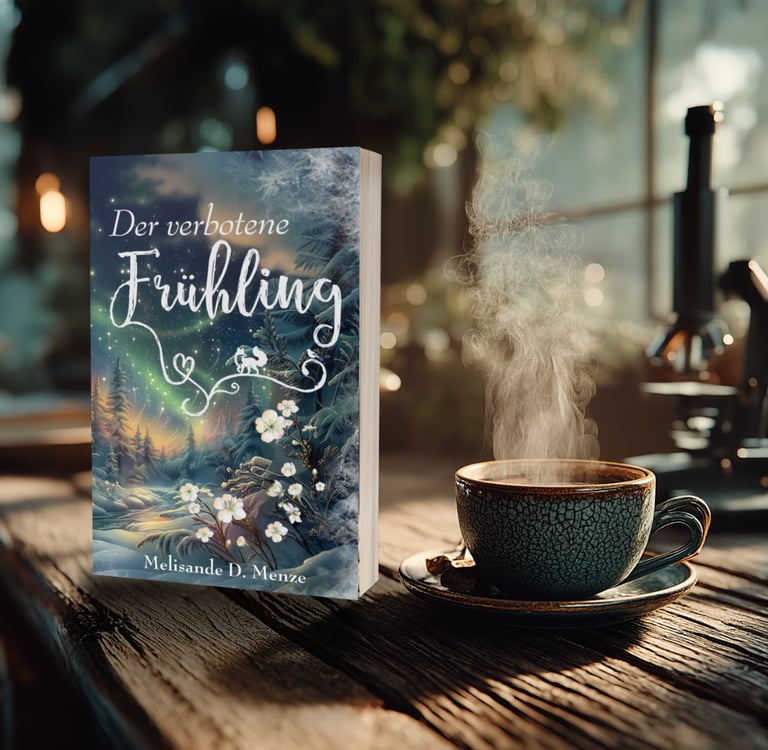
Magie erforschen?
Geht das überhaupt?
Die Frage hat mich nicht losgelassen: Kann man Magie wissenschaftlich erforschen? Mein erster Impuls war ganz nüchtern: Fakten sammeln, Überschneidungen markieren, mit bestehenden Daten abgleichen – auch wenn es um ein „magisches“ Phänomen geht. Denn, Hand aufs Herz: Was ist Wissenschaft anderes als die geduldige Entzauberung des Unerklärlichen? Arthur C. Clarke hat es radikal formuliert: „Any sufficiently advanced technology is indistinguishable from magic.“ (1962) – ein Satz, der mir bei der Arbeit am Roman ständig im Kopf klang.
Dass „Magie“ und Technik schon früher dicht beieinander lagen, zeigen die spektakulären Elektrizitäts‑Vorführungen des 19. Jahrhunderts: Von den Royal‑Institution‑Christmas Lectures mit Faradays verblüffenden Demonstrationen bis hin zu Nikola Teslas Bühnenshows mit Hochspannungsbögen – wissenschaftliche Erkenntnis wurde ganz bewusst als Staunen inszeniert.
Genau so bin ich vorgegangen: Erst habe ich mit mir selbst philosophiert (Philosophen wie Demokrit dachten schon im 5. Jh. v. Chr. über „Atome“ nach), dann mit Unterstützung von Catrina Seiler und Katja Kobusch den Plot besprochen – und schließlich mit zwei Studierenden der Universität Helsinki gesprochen.
Universität Helsinki, Viikki Campus & Studienalltag
Helsinki ist eine traditionsreiche Forschungsuni mit 11 Fakultäten auf vier Campussen und über 50 Masterprogrammen (darunter ~35 auf Englisch). Der Viikki‑Campus bündelt Lebens‑, Agrar‑, Forst‑, Veterinär‑ und Pharma‑wissenschaften – die „grüne“ Forschungsblase der Stadt.
Aus meinen Gesprächen und Notizen: Der Studienalltag wirkt strukturiert, aber menschlich – Kreditpunkte statt „Riesen‑Examen“, viel Wechsel zwischen Seminar, Labor, Gruppen‑ und Einzelarbeit. Wohnen meist in Studierenden‑wohnungen oder WGs; Waschen per Reservierungssystem, teils kostenlos oder klein verrechnet. Mentale Gesundheit ist ein Thema, zu dem es an der Uni konkrete Anlaufstellen gibt (z. B. FSHS/YTHS, SelfChat, Beratungen).
Biologie – warum sie mich so interessiert
Biologie war schon immer eines meiner liebsten Fächer. Von Mendels Theorien der Vererbung bis hin zu modernen Ansätzen – es steckt eine innere Logik dahinter, die mich bis heute begeistert. Selbst der „goldene Schnitt“, den man sonst eher aus Kunst und Architektur kennt, taucht in der Natur auf: in der spiralförmigen Anordnung von Sonnenblumenkernen, in Kiefernzapfen oder Muscheln. Sogar in der Struktur unserer DNA gibt es Proportionen, die erstaunlich nah an diesem Verhältnis liegen.
Gleichzeitig macht Biologie deutlich, wie viele Lücken noch bestehen. Bis heute sind Frauen in klinischen Studien oft unterrepräsentiert. Medikamente werden vielfach nach männlichen Körpermodellen entwickelt – die Folge: Frauen erleiden fast doppelt so häufig Nebenwirkungen. Solche Beispiele zeigen, dass Biologie nicht nur Antworten liefert, sondern auch Fragen aufwirft, die für unser tägliches Leben entscheidend sind.
Mich faszinieren auch die noch kaum erforschten Verbindungen – etwa zwischen Magen und Gehirn oder die Frage, welche Rolle einzelne Organe für unsere Wahrnehmung spielen. Manche sprechen sogar von einem „sechsten Sinn“, einem Gespür für Dinge, die sich wissenschaftlich nur schwer fassen lassen. Bücher wie Das geheime Band von Peter Wohlleben greifen solche Ideen auf und zeigen, wie tief unsere Wahrnehmung mit der Natur verknüpft ist – vom Geruch des Waldes bis zur Wärme eines Kaminfeuers, das uns bis heute instinktiv Geborgenheit vermittelt.
Doch nicht nur der menschliche Körper ist ein Rätsel. Flora und Fauna überraschen mich immer wieder. Mäuse zum Beispiel sind in der Lage, einander zu reanimieren – und dennoch betrachten wir sie fast ausschließlich als Versuchstiere. Auch in meinem Roman Der verbotene Frühling tauchen sie in diesem Kontext auf. Das wirft unweigerlich Fragen nach Ethik und Verantwortung auf.
Und dann die Pflanzenwelt: Pilze, die Plastik oder sogar radioaktive Abfälle abbauen können. Wurzeln, die Wasserquellen „hören“. Solche Phänomene lassen mich staunen und machen mich demütig.
Für mich ist Biologie deshalb so spannend, weil sie beides ist: präzise Wissenschaft und ein ständiges Erinnern daran, wie viel wir noch nicht verstehen. In diesem Spannungsfeld wirkt sie manchmal fast wie Magie – nur eben eine, die sich Schritt für Schritt entschlüsseln lässt.
Fun Fact am Rande: Nach dem ersten Durchgang von „Der verbotene Frühling“ war meine Lektorin überzeugt, ich müsste Medizin studiert haben. Das war natürlich nicht der Fall – aber es hat mich gefreut, dass meine Faszination für Biologie so glaubwürdig in den Text geflossen ist.
Molekularbiologie & Evolutionsbiologie
Molekularbiologie und Evolutionsbiologie gehören für mich zu den spannendsten Disziplinen überhaupt, weil sie auf unterschiedlichen Ebenen dieselbe Frage stellen: Was macht Leben aus?
Die Molekularbiologie untersucht Prozesse im Kleinsten – Gene, Proteine, Stoffwechselwege. Sie zeigt, wie winzige Veränderungen im Erbgut enorme Folgen haben können, und liefert Methoden, um diese Veränderungen sichtbar zu machen: Genomik, Proteomik, Bioinformatik.
Die Evolutionsbiologie dagegen betrachtet das große Ganze. Sie fragt nach dem „Warum“: Warum verschwinden manche Arten, während andere überleben? Wie entstehen Anpassungen an Umweltbedingungen? Welche Rolle spielen Zufall und Selektion?
An der Universität Helsinki sind diese beiden Bereiche eng miteinander verknüpft. Das Masterprogramm kombiniert klassische Vorlesungen, Laborarbeit und Datenauswertung, ergänzt durch Projekte, die auch in Zusammenarbeit mit Forschungsgruppen oder im Ausland durchgeführt werden können. Statt einer einzigen großen Abschlussprüfung sammeln die Studierenden ECTS-Punkte, und die Masterarbeit ist wie ein kompaktes Forschungsprojekt – ein Semester voller konzentrierter Arbeit an einer klaren Fragestellung.
Für mich als Autorin war das besonders interessant, weil genau hier die Schnittstelle liegt, die ich in meiner Geschichte aufgreifen wollte: Molekularbiologie liefert die Werkzeuge, Evolutionsbiologie den Kontext. Zusammen ergeben sie ein Bild, das sowohl ins Detail geht als auch die langen Linien sichtbar macht – genau das, was ich gebraucht habe, um meinen hypothetischen Fall in Der verbotene Frühling glaubwürdig zu gestalten.
Biologie – die Magie des Lebens und Liebens?
Um für meinen Roman die richtigen Einblicke zu bekommen, habe ich das Buddy-System der Universität Helsinki genutzt. Normalerweise dient es dazu, dass Interessierte unkompliziert mit Studierenden ins Gespräch kommen, die bereits im Programm sind. Ich habe es ein wenig anders verwendet: nicht um mich über den Campusalltag zu informieren, sondern um gezielt nach Studierenden zu suchen, die Molekularbiologie oder Evolutionsbiologie studieren – und die Lust hatten, sich mit mir über meinen hypothetischen Fall zu unterhalten.
So bin ich mit zwei Studierenden ins Gespräch gekommen. Ich habe ihnen keinen fertigen Plot präsentiert, sondern Stück für Stück erzählt, wie es in Der verbotene Frühling beginnt: Zunächst das, was Jaro in seinen Berichten beschreibt und was beim Forstamt gemeldet wird – also nur die Symptome, nicht die Ursache. Meine Frage war: Wie würdet ihr reagieren, wenn so etwas in der Realität auftauchte?
Ihre Antworten waren pragmatisch: Zuerst Daten sammeln, Proben nehmen, prüfen, was sich überhaupt im Feld analysieren lässt. Hypothesen aufstellen erst danach. Als ich im nächsten Schritt mehr über mögliche Auslöser preisgab, gingen sie tiefer ins Detail: Welche Analysen wären im mobilen Labor denkbar, welche müssten später ins Institut verlegt werden? Wie dokumentiert man zuverlässig, wenn man nicht im geschützten Uni-Rahmen arbeitet, sondern draußen in der Natur?
Diese Gespräche waren kein Interview, sondern ein echter Austausch. Ich habe Fragen gestellt, sie haben frei erzählt, wie sie selbst vorgehen würden, und wir haben die einzelnen Schritte gemeinsam durchgesprochen. Für mich war das unglaublich wertvoll. Ich habe nicht nur Methoden kennengelernt, sondern auch die Denkweise: wie Studierende Probleme strukturieren, wie vorsichtig sie mit Hypothesen umgehen und wie viel Begeisterung dahintersteckt, wenn man tiefer in ein Thema eintaucht.
Und dabei wurde mir klar: Forschung ist alles andere als cozy. Im Buch kann ich meine Figuren an ein Feuer setzen, ihnen Tee in die Hand drücken und das Laborzelt romantisch schimmern lassen. In der Realität bedeutet Forschung: Pipetten, die nicht wollen, wie man will. Feldarbeit, bei der Geräte nicht mitspielen oder Proben kontaminiert werden. Und im Labor Tierversuche, bei denen Mäusegehirne zerschnitten oder Zellkulturen stundenlang unter sterilen Bedingungen präpariert werden müssen. Wissenschaft ist Kleinarbeit, präzise, manchmal mühsam und oft mit Bildern verbunden, die alles andere als heimelig sind.
Gerade dieser Kontrast hat mir aber geholfen, den Roman lebendig zu machen: Ich wusste, wo ich die Realität einbeziehe – und wo ich sie bewusst weglasse, um den cozy-Ton meiner Geschichte zu bewahren.
Im Gespräch wurde mir außerdem klar, wie eng Biologie und Liebe miteinander verbunden sind. Die ersten großen Gefühle lassen sich mit Hormonen erklären: Dopamin, Adrenalin, Serotonin. Doch im Laufe der Zeit entwickelt sich etwas anderes, Tieferes – Vertrauen, Verlässlichkeit, Bindung. Und genau an dieser Schnittstelle wollte ich meine Geschichte ansiedeln.
Denn was Biologie im Kleinen erforscht – molekulare Prozesse, evolutionäre Anpassungen – erinnert mich daran, dass auch Gefühle ihre Mechanismen haben. Aber anders als Gene oder Proteine lassen sie sich nicht berechnen. Vielleicht ist es genau das, was Liebe am Ende magisch macht.
Was hat das alles mit Liebe zu tun?
Wenn man in Finnland über Liebe spricht, merkt man schnell: Sie wird oft stiller gelebt. Worte sind knapp, Gesten umso bedeutsamer. Ein gemeinsames Schweigen am See, ein Blick, ein mitgebrachtes Stück Schokolade – das ist manchmal mehr als große Liebeserklärungen. Für mich als Autorin war das eine Herausforderung: Deutsche Leser:innen erwarten meist mehr Emotionen, mehr Dramatik. Also musste ich einen Balanceakt finden: nah am finnischen Realismus bleiben, ohne die emotionale Tiefe zu verlieren, die wir hierzulande von Liebesgeschichten gewohnt sind.
Auch die finnische Mythologie kennt verschiedene Gesichter der Liebe. Lempo (auch Lempi) war ursprünglich ein Geist oder Dämon der Liebe. In späteren Überlieferungen wurde er jedoch stark negativ aufgeladen – mit Chaos, Wahnsinn und zerstörerischer Leidenschaft. Im Kalevala führt Lempo sogar Helden ins Verderben. Sukkamieli hingegen gilt in Volksüberlieferungen als eine Art Liebesfee oder -geist. Ihr Name bedeutet „Strumpfgeist“. Sie wird mit Frühlingsbildern assoziiert – Wärme, Aufbruch, junge Liebe. Aber auch sie ist unberechenbar: Sie beeinflusst Gefühle nach ihrem eigenen Spieltrieb, mal zum Guten, mal zum Schlechten.
Für mich ist klar: Liebe vereint beides. Biologisch gesehen beginnt sie mit einem Hormonsturm – Dopamin, Adrenalin, Serotonin –, ein Rausch, der uns Nähe suchen lässt. Doch das allein trägt nicht. Später entwickelt sich etwas Tieferes: Vertrauen, Verlässlichkeit, ein Ineinandergreifen von Eigenheiten. Man kennt die Macken des anderen und bleibt trotzdem. Oder gerade deswegen. Für mich ist das Liebe – wenn man sich ergänzt, respektiert und trägt.
Und während in Kulturen wie der griechischen oder italienischen Literatur die Liebe oft überschäumend beschrieben wird, findet man in Finnland weit weniger Texte darüber. Vielleicht, weil Liebe dort eher gelebt als ausgesprochen wird. Genau das wollte ich in meinem Roman sichtbar machen: nicht nur die Biologie, nicht nur die Mythologie, sondern diese stille, manchmal unscheinbare, aber unerschütterliche Kraft, die größer ist als beides.
Schlusswort
Am Ende blieb für mich eine Erkenntnis: Wissenschaft und Mythologie widersprechen sich nicht, sie ergänzen sich. Die Biologie erklärt, wie Gefühle entstehen, die Sagen zeigen, welche Macht sie über uns haben – und dazwischen liegt die menschliche Erfahrung, die man weder messen noch vollständig erzählen kann.
Genau dort wollte ich meinen Roman Der verbotene Frühling verankern: zwischen Daten und Deutung, zwischen nüchterner Forschung und dem Staunen über das, was größer ist als wir. Vielleicht ist das die wahre Magie – dass wir forschen können, ohne je alles zu begreifen, und dass genau in diesem Dazwischen Geschichten entstehen.
Was denkt ihr darüber? Wo liegt für euch die Magie, der Zauber des Lebens?
